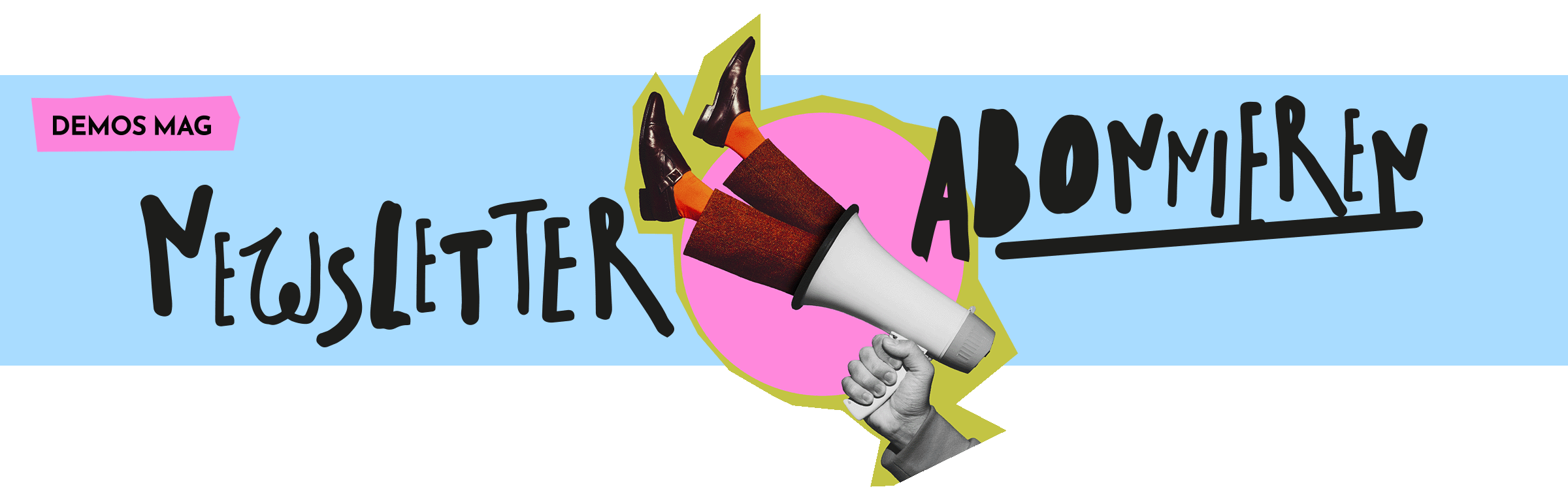„Du bist ja auch was Besseres!“
Bildungsaufstieg und Loyalitätskonflikte
Wenn Menschen durch das Erreichen eines höheren Qualifikationsniveaus auch sozial aufsteigen, zieht das Loyalitätskonflikte nach sich: Im bisherigen sozialen Umfeld gehört man nicht mehr richtig dazu, im neuen fühlt man sich noch nicht willkommen. Das kostet Kraft, weiß unsere Autorin.
Kürzlich saß ich mit einem befreundeten Journalisten in einem italienischen Restaurant. Wir aßen Pizza und sprachen über unsere Romanprojekte, das tun wir regelmäßig. Es geht dann um die Geschichten, die wir erzählen wollen, um die Figuren, die darin vorkommen, oft auch um handwerkliche Dinge und manchmal um die Branche. Ich sprach gerade einen Gedanken über den deutschen Literaturbetrieb aus, als er mich ansah und sagte, er kenne keine Person, die so viele Einschübe, Nebensätze und Fremdwörter beim Sprechen verwende wie ich. Uff. Er hat recht, und ich weiß es.
Bildungsaufstieg verändert
Was ich auch weiß, inzwischen jedenfalls, ist, warum ich das mache und woher es kommt. Ich bin in einer sogenannten Nichtakademikerfamilie aufgewachsen, bin das erste Familienmitglied, das Abitur gemacht, eine Universität besucht und einen akademischen Grad erworben hat. Der Fachbegriff für diesen Umstand lautet Bildungsaufstieg. Es geht dabei zunächst um den Aufstieg auf ein höheres Qualifikationsniveau, in der Folge aber um viel mehr: Mit dem Bildungsaufstieg kann sich auch der soziale Status verändern, und damit verändert sich oft die unmittelbare Welt einer Person. Zum gewohnten Umfeld kommt ein neues hinzu, und die betreffende Person muss erst einmal lernen, sich in diesem neuen Umfeld zu bewegen. Ein zentrales Element ist die verwendete Sprache.
Ich habe wenig konkrete Erinnerungen an meine Schulzeit, besitze aber noch das erste Zeugnis aus der Grundschule. Dort steht, dass ich über einen für mein Alter ungewöhnlich großen Wortschatz verfügte. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass ich mit etwa vier Jahren Lesen lernte und mir mein Vater außerdem jeden Sonntagmorgen aus einem dicken, zerschlissenen Wilhelm-Busch-Sammelband vorlas. Unser Spiel war, dass er nach einiger Zeit anfing, einzelne Worte gegen andere auszutauschen, und ich hatte großen Spaß dabei zu protestieren, wenn ich es bemerkte.
Spätestens mit der Pubertät veränderte sich das mit dem Spaß. Ich bin nicht sicher, warum die Differenz zwischen uns immer größer wurde, ob es an der Lebensphase lag, dass wir gegeneinander kämpften, oder ob es noch einen ganz anderen Grund gibt, den ich nicht kenne. Jedenfalls wurden die Auseinandersetzungen immer mehr, immer öfter bekam ich zu hören, ich sei neunmalklug und müsse nicht zu allem meine Meinung kundtun. Nach der Pubertät wurde es auch nicht besser, und als ich in meiner ersten Festanstellung bereits parallel zum Studium schnell mehr Verantwortung erhielt und nebenbei, hauptsächlich nachts, mein Examen machte, sagte er in Konfliktsituationen oft den Satz: „Du hast ja auch studiert.“ Ich hörte das als: „Du bist ja auch was Besseres.“ Er sagte das dann, wenn er im Konflikt kapitulierte.
„Mit dem Bildungsaufstieg kann sich auch der
soziale Status verändern,
und damit verändert sich oft die
unmittelbare Welt einer Person.“
Zweifacher Loyalitätskonflikt
Der Erziehungswissenschaftler Aladin El-Mafaalani beschreibt in seinem Buch „Mythos Bildung“ den Loyalitätskonflikt, den Bildungsaufsteiger:innen sich gleich zweifach einhandeln: Sie wollen loyal gegenüber ihrer Herkunftsumgebung sein, wollen nach wie vor dazugehören, während gleichzeitig die Unterschiede im Hinblick auf Sprache, Bildung, Themen sowie auf Verhaltensweisen und soziale Praktiken immer größer werden. Auf der anderen Seite kommen sie in einer neuen Umgebung an, zu der sie dazugehören wollen, deren Sprache sie aber noch nicht beherrschen. Damit meine ich nicht Sprache im Sinne einer Landessprache, sondern im Sinne verwendeter Worte, Floskeln, Codes. Auch sind häufig die für diese neue Umgebung typischen sozialen Interaktionsmuster nicht bekannt.
Für mich waren das solche Dinge wie das Sichzurechtfinden am Frankfurter Flughafen bei meinem ersten Flug in die Vereinigten Staaten, den ich berufsbedingt bald nicht mehr vermeiden konnte. Ich war noch nie zuvor an einem Flughafen gewesen, von Frankfurt Hahn, das mit Frankfurt und streng genommen auch mit Flughafen recht wenig zu tun hat, einmal abgesehen. Dort war ich mit meinem damaligen Partner in eine kleine Maschine nach Glasgow gestiegen, um für den beruflichen Ernstfall zu üben. Darauf vorbereitet, mit mehreren Terminals klarzukommen, meinen Weg in die richtige Abflughalle und dann zum Check-in, zur Gepäckaufgabe, von dort zur Sicherheitskontrolle und schließlich zum Abfluggate zu finden, hat es mich nicht. Zumal das in den frühen 2000er-Jahren war, hinreichend komplex zwar schon damals, aber noch mit ausgedrucktem Papierticket und ohne Google auf dem Mobiltelefon.

Menschen, die gut situiert aufgewachsen sind, schauen mich manchmal verständnislos, oft auch peinlich berührt an, wenn ich eine dieser Geschichten aus meinem Leben erzähle. Ich bin nicht in Armut aufgewachsen, allenfalls in prekären Verhältnissen, in denen Flugreisen nicht drin waren, als das noch eine Frage des Geldes und nicht des Klimaschutzes war. Ich war bereits jenseits der 30, als ich das erste Mal in ein Flugzeug stieg. Dass ich oft Fremdworte nicht kenne, trotz des Literaturstudiums Bücher nicht gelesen habe oder bei „name droppingDurch das wiederholte Verwenden der Namen bekannter, prominenter Personen wird der Anschein erweckt, diese näher zu kennen. Die Person, die name dropping verwendet, verfolgt damit die Absicht, den eigenen sozialen Status aufzuwerten.“ nur fragend in die Runde schauen kann, irritiert. Mich mindestens genauso. Deshalb habe ich mir über die Jahre eine Bewältigungsstrategie angeeignet. Mir hilft, dass ich ein gutes Sprachgedächtnis habe, schnell lerne und sehr schnell lese. Dadurch habe ich einiges nachholen können, und doch bin ich immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen ich mich schäme, weil ich anders bin als viele Menschen, die mir in meinem heutigen beruflichen Umfeld als Beraterin und Autorin begegnen.
Bewältigungsstrategien
Dass Menschen Strategien entwickeln, um sich vor Diskriminierung zu schützen, kommt so häufig vor, dass es dafür einen eigenen Begriff gibt: „stereotype threatBewältigungsstrategie zur Vermeidung eigener Stereotypisierung oder Be-/Abwertung aufgrund von Vorurteilen“. Die Verhaltenswissenschaftlerin Dr. Pragya Agarwal beschreibt dieses Phänomen als Reaktion auf die Angst, dass unser Verhalten durch eine stereotypisierende Linse betrachtet werden könnte und man uns dadurch vorurteilsbehaftet be- und abwertet. Diese Angst kann unabhängig von einer tatsächlich auftretenden Stereotypisierung so immens sein, dass wir uns vorsorglich gegen diese Stereotypisierung verhalten.
Dass dies ein Mechanismus ist, den ich selbst permanent anwende, ist mir zuletzt bewusst geworden, als ich eine Person, die ich schon länger schätze, zum ersten Mal persönlich traf. Ich halte ihn, Wissenschaftler und ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet, für sehr kompetent und sehr klug, zudem mag ich seinen Humor. Als wir uns auf einer Veranstaltung unterhielten, fiel mir außerdem etwas auf, das mir eigentlich überhaupt nicht wichtig ist: Ich bin einige wenige Zentimeter größer als er. Noch während des Gesprächs wurde mir bewusst, dass ich mich immer wieder bemühte, mich körperlich so klein wie möglich zu machen, damit der Unterschied nicht so wahrnehmbar war – eine unbewusste Reaktion auf eine der Konventionen, mit denen ich aufgewachsen bin: Frauen sollen zu Männern aufschauen.
Mir ist das weder wichtig, noch machte es für die Situation einen Unterschied, dennoch verhielt ich mich automatisch so, dass ich im besten Falle eine mögliche Vorverurteilung würde vermeiden können, denn wer weiß: Vielleicht machte es ja für mein Gegenüber einen Unterschied.
Agarwal, das erläutere ich in meinem Buch „Quick Guide Unconscious Bias“ ausführlicher, beschreibt nicht nur das Phänomen als solches, sie hat auch untersucht, ob und inwieweit sich „stereotype threatBewältigungsstrategie zur Vermeidung eigener Stereotypisierung oder Be-/Abwertung aufgrund von Vorurteilen“ auswirkt: Die Leistung kann signifikant sinken, denn wenn Personen in hohem Maße damit beschäftigt sind, sich entlang gängiger Konventionen zu verhalten, bindet das Ressourcen, die für die Bearbeitung der eigentlichen Themen und Aufgaben dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Bildungsaufstieg hat also einen Preis. Wenn Menschen den sozialen Status wechseln, ist allein das schon anstrengend. Sich dann innerhalb der neuen Umgebung anzupassen, die neuen Regeln zu lernen und sicherzustellen, dass möglichst wenige denken, man gehöre hier nicht her, ist es umso mehr.
Beim Schreiben meines Romans bin ich immer wieder mit Phasen konfrontiert, in denen ich am liebsten hinschmeißen will. Ich denke dann entweder, dass ich überhaupt nicht schreiben kann, Fiktion schon gar nicht, oder aber, dass ich zwar eine gute Geschichte im Kopf habe, aber viel zu kompliziert schreibe. Seit mehr als drei Jahren geht das nun schon so. Ich bin froh, dass es Menschen wie meinen Freund, den Journalisten, gibt, die mir sagen, was sie denken, und mir zeigen, dass ich mit all meinen Fehlern und Limitierungen willkommen bin, auch in dieser für mich einmal mehr neuen Umgebung.

fürs DEMOS MAG
Du willst das DEMOS MAG unterstützen, weil guter, diverser Journalismus Dir am Herzen liegt und Du auch denkst, dass Demokratie keine Selbstläuferin ist? Dann spende einmalig mit einer eSpende oder werde Abonnent:in auf Steady.
Fördere mit uns den gesellschaftlichen Diskurs und gib mit Deiner Spende den im Mainstream unterrepräsentierten Stimmen mehr Gewicht.