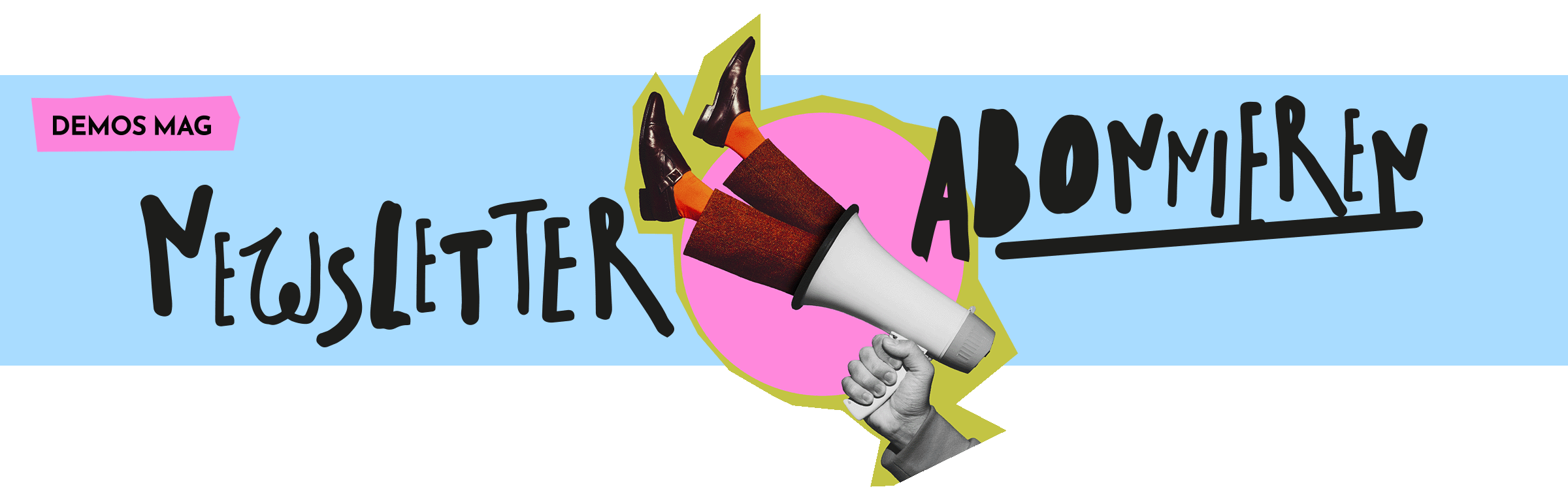Mehr als eine Wahrheit
Der Ambiguität des Lebens mit Toleranz begegnen
Die Herausforderungen, vor denen wir persönlich und als Gesellschaft stehen, scheinen immer komplexer. Es gibt nicht mehr die eine Wahrheit und auch keine absolute Sicherheit. Stattdessen müssen wir lernen, mit Ambiguitäten zu leben – ein Schritt, der das eigene Leben durchaus bereichert.
Kennst Du Teekesselchen? Das lustige Spiel, bei dem man gemeinsam nach Wörtern sucht, die zwei oder sogar mehrere Bedeutungen haben? Kapelle ist so ein Wort oder Hahn. Sprachwissenschaftler:innen bezeichnen derartige Begriffe als Homonyme, das Phänomen der Mehrdeutigkeit selbst wird Ambiguität genannt. So witzig Teekesselchen als Zeitvertreib auf langen Autofahrten auch sind – im Alltag mögen wir Menschen diese Mehrdeutigkeit eher nicht. Da wollen wir gern wissen, woran wir sind, damit wir Sachverhalte richtig kategorisieren und einordnen können. Einfach und eindeutig soll es bitte sein. Gern auch schwarz oder weiß.
Freund oder Feind?
Aber ist das Leben so? Kann ich gleichzeitig gegen Gewalt und für Waffenlieferungen sein? Kann ich Fleisch lieben und Tierquälerei verabscheuen? Ist es möglich für mich, zu gendern, obwohl mir das Konzept dahinter fremd bleibt? Solche Fragen mit sich selbst zu klären, ist schon herausfordernd genug, noch komplizierter wird es, wenn es nicht um uns, sondern um andere geht. Der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie, Künstliche Intelligenz – die Liste der Ereignisse oder Herausforderungen ließe sich beliebig fortsetzen. Sie alle erfordern komplexes Denken, das über den eigenen Horizont hinaus reicht. Und sie beinhalten meist mehr als eine Wahrheit, was wiederum einen Perspektivwechsel fordert, also die Fähigkeit, die eigene Denkbox oder eben auch die eigene Komfortzone zu verlassen. Das ist zuweilen anstrengend. Zumal uns oft genug schon der Alltag und die inneren Kämpfe, die wir mit uns selbst austragen, erschöpfen. Ein Grund, warum sich viele Menschen mehr und mehr zurückziehen, warum Freundschaften zerbrechen oder die Praxen der Psycholog:innen überfüllt sind. Wir sehnen uns nach Einfachheit und damit auch nach Menschen und Situationen, die uns diese Einfachheit versprechen.
Effizienzmaschine Gehirn
Um zunächst zu verstehen, warum wir uns so schwer damit tun, die Ambiguität des Lebens anzunehmen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Arbeitsweise unseres Gehirns. Das verbraucht im Gegensatz zu anderen Organen unglaublich viel Energie: Selbst wenn wir lässig auf dem Sofa chillen, sind es rund 20 Prozent des gesamten Energieumsatzes. Und auch wenn die Steigerung des Energieverbrauchs bei der Lösung hochkomplexer Aufgaben gar nicht so gravierend ist wie zum Beispiel die in der Beinmuskulatur bei einem Sprint, so ist das Gehirn trotzdem darauf getrimmt, möglichst effizient und energiesparend zu arbeiten. Und das gelingt nun mal besser, wenn die Dinge klar auf der Hand liegen. Für uns müssen die Dinge wahr sein. Ambiguität im Sinne von Mehrdeutigkeit fügt sich in dieses Konzept nicht so gut ein. Das ist allerdings nur ein Aspekt.
Wie sich Empathie und Ambiguitätstoleranz ergänzen
Ein weiterer ist, dass Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, aufgeschlossen gegenüber Mehrdeutigkeiten zu sein, ein ganzes Paket an Eigenschaften von uns fordert. Eigenschaften, die ihrerseits nicht angeboren sind, sondern erworben werden. Haltung zum Beispiel. Selbstbewusstsein. Oder Empathie. Wer vor der Aufgabe steht, sein Gegenüber auch mit jenen Eigenschaften zu respektieren, die einem selbst vielleicht gegen den Strich gehen, dem hilft Empathie, sich einzufühlen und zu verstehen, warum der oder die andere so ist, wie er oder sie ist. Man muss nicht zwangsweise alles mögen, was andere tun, aber dass sie es tun, macht sie noch lange nicht zu schlechten Menschen, sondern zu Menschen, die eben lediglich anders denken oder handeln, als man selbst.

Müssen wir alles tolerieren?
Konsequent zu Ende gedacht, bedeutet das auch, auszuhalten, dass Gleiches eben nicht mit Gleichem beantwortet werden sollte. Eine Erkenntnis, die sich unter anderem in unserer Rechtsprechung manifestiert hat. So gibt es in Deutschland keine Todesstrafe mehr. Das gefällt nicht allen, wie man regelmäßig in den Sozialen Medien lesen kann. Da wird schon mal lauthals nach der ungnädigen, starken Hand gerufen, wenn aufgrund belastender Ereignisse die eigene Hilflosigkeit überbordet. In seinem Buch „Kaffee und Zigaretten“ schreibt Ferdinand von Schirach über die RAF-Prozesse in Stammheim den Satz: „Kaum jemand wollte verstehen, dass auch Terroristen Menschen sind, dass auch sie Würde besitzen“. Und ja, auch das bedeutet Ambiguitätstoleranz: Auszuhalten, dass man Verhalten missbilligen kann, dass dahinter aber immer ein Mensch steht. Und dass sich das, was wir als gerecht empfinden, manchmal von dem unterscheidet, was die Rechtsprechung sagt. Dazu kommt, dass wir selbst auch nicht gefeit davor sind, abzurutschen oder im gesellschaftlichen Sinne falsch zu agieren. Am Ende ist nämlich das auch eine Frage der Norm, also eine Frage danach, wo der gesellschaftliche Konsens liegt, der wiederum, wie die Geschichte zeigt, einem steten Wandel unterliegt.
Blick auf uns selbst
Das, was uns helfen würde, Ambiguitäten anzunehmen, ist gleichzeitig auch das, was die meisten Menschen gern umgehen, nämlich den Blick weg von „den anderen“ auf sich selbst zu richten. Maßgeblich dafür sind das Spüren und die Einordnung der eigenen Gefühle. Leider gehört das zu den Fähigkeiten, die unsere Gesellschaft nicht gerade fördert. Wann oder wo haben Menschen Raum für die Frage: Wie geht es mir eigentlich tief in mir mit dieser oder jener Herausforderung? Was macht es mit mir, das Leid in der Ukraine zu sehen und gleichzeitig aber zu wissen, dass Gewalt keine Lösung sein sollte? Es ist in Ordnung, mit Hilflosigkeit, Wut oder Traurigkeit zu reagieren. Und das wäre auch der nächste Schritt: Die eigenen Gefühle zu akzeptieren, statt sie nach außen auf andere zu projizieren. Man darf angesichts einer Pandemie, bei der auch viele Politiker:innen nicht immer die beste Lösung parat haben, wütend sein. Wenn ich das für mich selbst akzeptiere und wenn ich akzeptiere, dass andere Menschen die Dinge vielleicht komplett anders betrachten als ich selbst, dann kann ich meine Energie darauf konzentrieren, meinen eigenen Beitrag zu leisten, statt sie an Nebenkriegsschauplätzen zu verpulvern.

Ungewissheiten sind Teil des Ganzen
In dem Film „Eat Pray Love“ sagt ein alter Mönch zur Hauptprotagonistin den Satz: „Wegen Liebe aus dem Gleichgewicht zu geraten, ist Teil des Gleichgewichts“. Ich mag diesen Satz, weil er etwas ausdrückt, was sich auf unsere immer komplexer und vielfältiger werdende Gesellschaft übertragen lässt. Wir sind Teil des Wandels und gleichzeitig Teil des Gleichgewichts, und zwar in jeder Hinsicht. Der Weg, sich auf die eine einzige Position zurückzuziehen, dort zu verharren und andere, die vorbeiziehen, zu beschimpfen, weil sie anders handeln, führt in eine Sackgasse und wird dem Leben nicht gerecht. Wer eine eigene Haltung und eine gefestigte Ich-Identität entwickelt hat, weiß, dass das Leben von Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten geprägt ist und dass diese die Chance bieten, sich selbst immer wieder zu reflektieren und an den Erkenntnissen zu reifen. Letztendlich geht es nicht darum, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob ich Fleisch essen und trotzdem Tierleid verurteilen kann, sondern darum, für mich eine Haltung zu entwickeln, die konsequent zu Ende gedacht, zu einer Lösung führt. Und auch die ist nicht in Stein gemeißelt, sondern kann wieder hinterfragt werden.
Gemeinsam wachsen
So wie Teekesselchen ein Spiel ist, das viel mehr Spaß bereitet, wenn es viele Mitspielende gibt, so hilft uns die Gemeinschaft ebenso dabei, komplexen Herausforderungen und Unsicherheiten zu begegnen. Der Blick auf sich selbst ist zwar heilsam, aber er braucht Resonanz, um verankert zu werden. Resonanz entsteht in der zwischenmenschlichen Begegnung, die gleichzeitig auch ein wunderbares Übungsfeld für die eigene Ambiguitätstoleranz ist. Mal nicht gleich zu antworten oder die eigene Position mit aller Macht zu verteidigen, sondern zuzuhören und mit staunender Offenheit der Haltung des Gegenübers zu begegnen, kann eine durchaus beglückende Erfahrung sein.

fürs DEMOS MAG
Du willst das DEMOS MAG unterstützen, weil guter, diverser Journalismus Dir am Herzen liegt und Du auch denkst, dass Demokratie keine Selbstläuferin ist? Dann spende einmalig mit einer eSpende oder werde Abonnent:in auf Steady.
Fördere mit uns den gesellschaftlichen Diskurs und gib mit Deiner Spende den im Mainstream unterrepräsentierten Stimmen mehr Gewicht.