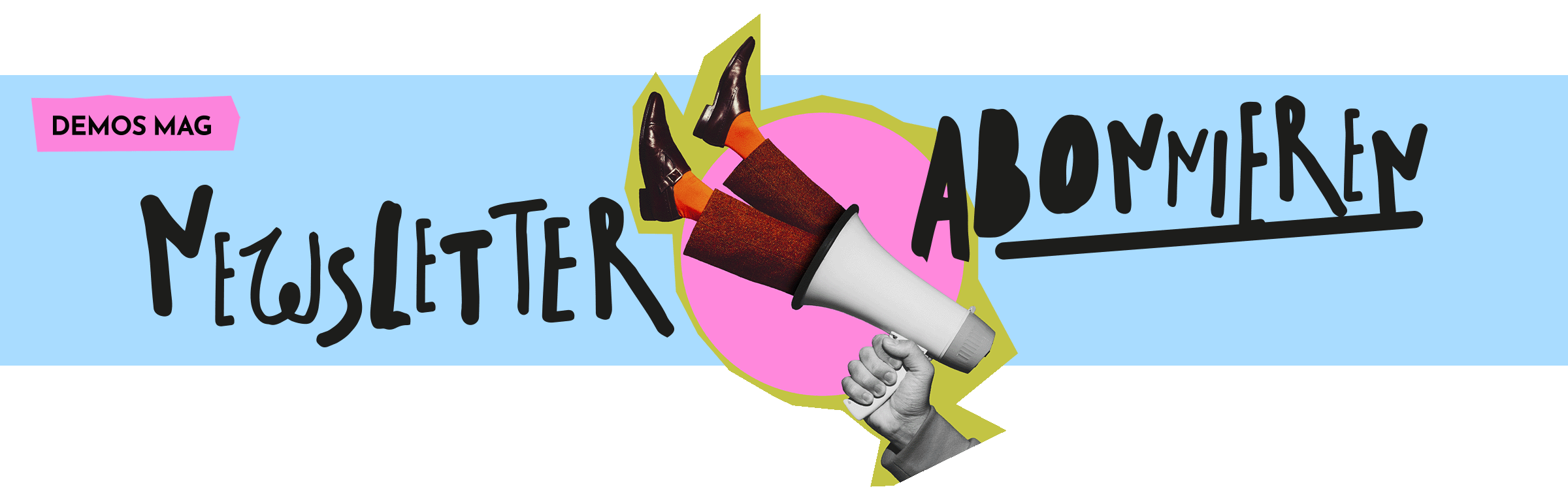Erinnerungskultur, postmigrantisch
Erinnerungsarbeit inklusiv gestalten – eine Zwischenbilanz
Wie gelingt uns als Gesellschaft eine inklusive Erinnerungskultur, die der postmigrantischen Realität Rechnung trägt und ihr gerecht wird?
Der deutsche Diskurs um Erinnerung hat Fahrt aufgenommen. Allein in den letzten Monaten war ich bei drei für mich wichtigen Veranstaltungen, in denen über die Möglichkeit eines postmigrantischen Erinnerns diskutiert wurde. Nicht immer mit der Überschrift „postmigrantischDas Wort postmigrantisch kann mit der Bezeichnung nach der Migration übersetzt werden. Es bedeutet aber nicht, dass die Migration in einem Gebiet beendet ist, sondern dass in der Phase nach der Migration Aushandlungsprozesse stattfinden, die durch die große Wirkung von Migrationsbewegungen in allen gesellschaftlichen Bereichen nötig sind.“ bezeichnet, fanden die kritischen Auseinandersetzungen nichtsdestotrotz innerhalb postmigrantischer Konstellationen statt, indem ganz unterschiedliche Erinnerungsarchive verhandelt wurden. Wie und was wir erinnern, ist bedeutsam dafür, wie wir auf die deutsche Geschichte blicken. Was wird sichtbar, welche Perspektiven und Geschichten bleiben verborgen?
Verbindungslinien?
Im September zum Beispiel fand eine von der Bildungsstätte Anne Frank und der Frankfurt University of Applied Sciences organisierte Veranstaltung statt, um sich an mögliche Verbindungslinien zwischen dem deutschen Kolonialismus und dem Holocaust zu erinnern. Den Start machte Prof. Dr. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, mit der Feststellung, dass es verheerend sei, „wenn die Erinnerung an den Holocaust als Konkurrenz für die Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit in Stellung gebracht wird.“ Vielmehr ginge es darum, zu schauen, „wie Erinnerung multidirektional funktionieren kann“, so Prof. Dr. Meron Mendel weiter.
Welche Perspektiven und Erfahrungen in den Kanon des Gedenkens eingehen, wer überhaupt die Möglichkeit hat, sich an der Gestaltung einer vielfältigen Erinnerungskultur zu beteiligen und wessen Geschichten erzählt und erinnert werden – und auf welche Weise eigentlich –, waren auch Fragen, die das von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgerichtete Symposium „Transformative Archive“ beschäftigte. Auch spielte die Wirkmächtigkeit des Kolonialismus eine zentrale Rolle, allerdings mit Blick auf „kolonial geprägte Archivwissenschaften“ und den Konsequenzen derselben in Bezug auf die Herausbildung von hegemonialen Narrativen und Geschichtsschreibungen. Eine zentrale Frage war, inwieweit „das Dokumentieren, Archivieren und die Bereitstellung von marginalisiertem (Geschichts)Wissen mitunter Räume eröffnet, in denen Neues gedacht und dekoloniale Optionen in der erinnerungspolitischen Landschaft Deutschlands und darüber hinaus besprechbar werden können.“

Ausgangspunkt hierbei war die Erkenntnis, dass weder Archive noch Praktiken des Archivierens neutral und objektiv sind, sondern dem Erinnern immer auch Machtverhältnisse eingeschrieben sind. Um mit der postkolonialen Theoretikerin Gayatri Spivak zu sprechen, ist die „archivarische Macht“ jene Macht „zu entscheiden, was ein ernsthafter Gegenstand der Forschung und damit der Erwähnung oder des Denkens ist und was nicht. Das, was ausgeschlossen wird,“ so Spivak weiter, „wird unmöglich zu denken oder wahrzunehmen; die archivarische Schwelle kann die Grenzen des historischen Wissens und des Denkens selbst abstecken.“
Vielschichtigkeit
Im Oktober hatte dann die Junge Islam Konferenz zu den diesjährigen JIK-Talks eingeladen, um der Frage nachzugehen, wie vielschichtiges und multiperspektivisches Erinnern gelingen kann, in dem marginalisierte Perspektiven zu Wort kommen und sichtbar werden. Unter dem Titel „Die Geschichten der Anderen – andere Geschichten“ waren Stimmen eingeladen, die innerhalb des deutschen Erinnerungsdiskurses durch Leerstellen gekennzeichnet und unsichtbar sind – antirassistische Kämpfe, Stimmen von ostdeutsch, Schwarz oder muslimisch positionierten Personen sowie die Geschichten und Erinnerungen von Rom*nja und Sinti*zze in Deutschland.
Diese Veranstaltungen sind für mich Beispiele, neben anderen, für die postmigrantischen Verschiebungen mit Blick auf Erinnerung. Nicht nur wird Erinnerungsarbeit diverser, sondern sie wird multiperspektivisch und vielschichtig. Dies gilt sowohl für die historischen Referenzen, die zum Beispiel mit der Erinnerung und Wirkmächtigkeit des deutschen Kolonialismus eine neue Tiefe gewinnen, aber auch für die diversen Positionalitäten und Erinnerungsstücke, die sich im Erinnerungsdiskurs wiederfinden. Gesellschaftlich verhandeln wir also nicht weniger als die Frage, an welches Leben wir uns als Gesellschaft erinnern wollen. Wie können wir als der weißen Dominanzgesellschaft Zugehörige diesen Prozess mitgestalten?
Wichtiger Ausgangspunkt ist zunächst die Einsicht, dass das Thema Erinnerung aus marginalisierter und migrantischer Perspektive eine widerständige Praxis darstellt, die innerhalb der weißen Dominanzgesellschaft stattfindet. Das heißt, die rassistischen Realitäten und ihre strukturellen Auswirkungen, denen People of ColorPeople of Color ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismus erfahren, und ist im Rahmen der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung entstanden. in dieser Gesellschaft ausgesetzt sind, tragen sich auch in unsere Erinnerungsarbeit. Erinnerungsarbeit wird deshalb aus der Perspektive von People of ColorPeople of Color ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismus erfahren, und ist im Rahmen der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung entstanden. wider dem hegemonialen Erinnern sein und dieses stören wollen und müssen. Dies wird anhand von zahlreichen Kämpfen deutlich, die gegenwärtig Straßennamen umbenennen, Fragen zur Reparation aufwerfen, die Rückgabe von Museums-„Objekten“ gestalten, Mahnmale für Betroffene von Rassismus fordern (Hanau), Mahnmale für vom Faschismus Getötete schützen (Berlin) und sich ständig vergegenwärtigen, dass wir erst tot sind, „wenn man uns vergisst“. Hierzu braucht es sowohl Allianzen zwischen den Communitys of Color als auch von weiß positionierten Menschen, die das hegemoniale Narrativ, seine Machtverhältnisse und Privilegien mitstören und helfen, im Sinne einer postmigrantischen Gegenwart umzugestalten. Entsprechend ist das Ziel dieser neuen Erinnerungskultur zu lernen, „dass es sowas wie ein vernachlässigbares Leben nicht gibt“, um es mit den Worten von Charlotte Wiedemann zu benennen.
Hierarchien und Opferkonkurrenz
Der öffentliche Diskurs und sein Erinnern produzieren und reproduzieren jedoch immer wieder Hierarchien und Opferkonkurrenz. Dieser Konkurrenzkampf entsteht laut Jessica Massòchua vor allem deshalb, „weil wir das Gefühl haben, eine weiße Dominanzgesellschaft überzeugen zu müssen.“ Dies gilt es, zu erkennen und kompromisslos aufzubrechen. Hierfür müssen wir aufhören, „uns an einem weißen Blick abzuarbeiten, und stattdessen kritisch hinterfragen, wo unsere eigenen Rassismen sind“, aktiv Allianzen und die Solidarität mit anderen Communitys suchen und gestalten. Hier gilt es, sich in Richtung eines gesellschaftlichen Zustands zu bewegen, in dem die unterschiedlichen Formen des Erinnerns nebeneinanderstehen dürfen, können und unterschiedliche Narrative der Erinnerung zirkulieren.
Um solchen Ausschlussmechanismen des öffentlichen Diskurses nicht zu verfallen, ist es notwendig, voneinander zu lernen, sich auf zahlreiche Perspektivwechsel einzulassen, intersektionales Denken zuzulassen und auch die eigenen Privilegien nicht aus dem Blick zu verlieren. Für Communitys von People of ColorPeople of Color ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismus erfahren, und ist im Rahmen der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung entstanden. gilt im Besonderen, dass das Erinnern noch erlernt bzw. kultiviert werden muss, so Hamze Bytyci. Viel „Wut und Scham steht dem Gedenken im Weg und so viele Traumata sind noch ungeklärt.“ Der Anspruch, eine multiperspektivische, inklusive und intersektionale Erinnerungsarbeit zu entwickeln, muss bedeuten, neue, friedliche, aber radikale Arten des Erinnerns entwickeln, finden und ausprobieren zu wollen, die nicht reine weiße Narrative und Erinnerungen bedienen. Das braucht zahlreiche Ressourcen, unter anderem Zeit, Geduld und Sensibilität, um dann kultivieren zu können, dass es möglich ist, unseren Schmerz untereinander zu teilen und somit auf „eine neue Art des Zusammenkommens“ zu leben.
Stakeholder und Plattformen, wie zum Beispiel die Junge Islam Konferenz, aber auch die Bundeszentrale für politische Bildung wie auch die Bildungsstätte Anne Frank, sind wichtige Orte, um nicht nur vielfältige Stimmen und Erinnerungen multiperspektivisch zusammenzuführen, sondern ihren Austausch und das kollektive Lernen nachhaltig zu kultivieren. Aber auch diese Orte müssen sich fragen, welche Erinnerung aufgrund von welchen Mechanismen noch nicht sicht- und hörbar geworden sind.


fürs DEMOS MAG
Du willst das DEMOS MAG unterstützen, weil guter, diverser Journalismus Dir am Herzen liegt und Du auch denkst, dass Demokratie keine Selbstläuferin ist? Dann spende einmalig mit einer eSpende oder werde Abonnent:in auf Steady.
Fördere mit uns den gesellschaftlichen Diskurs und gib mit Deiner Spende den im Mainstream unterrepräsentierten Stimmen mehr Gewicht.