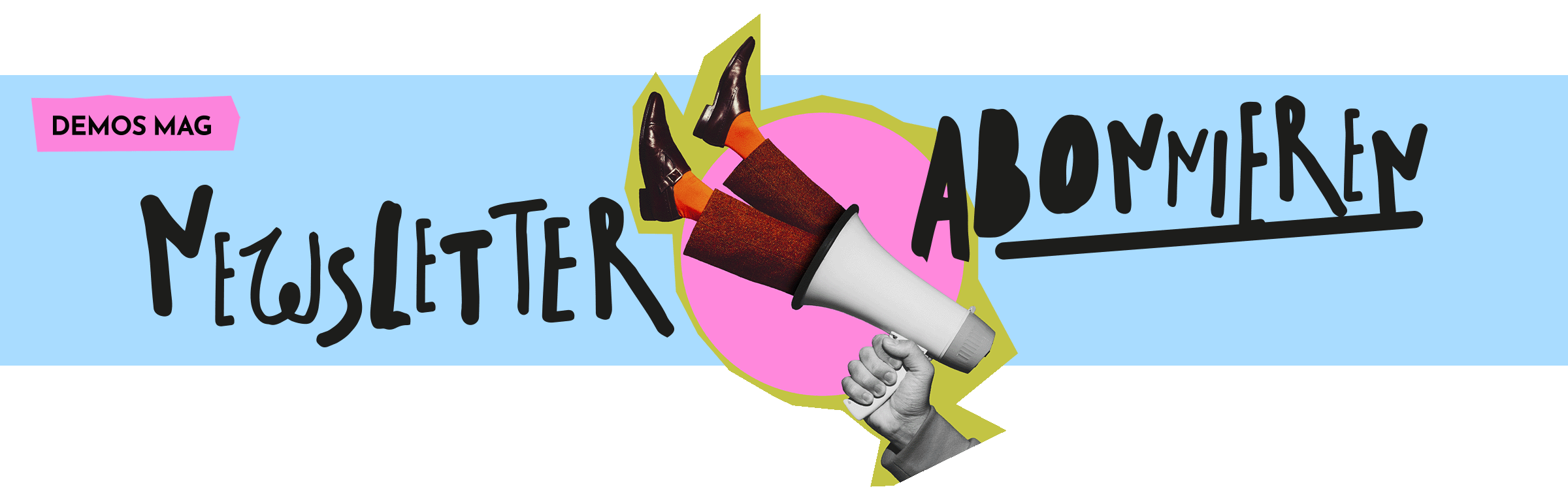Vor verschlossenen Türen
Zwei Generationen von Gastarbeiter:innenkindern über ungleiche Startbedingungen, Hürden auf dem Bildungsweg und geteilten Erfahrungen als Grenzgänger:innen.
Heute haben etwa 20 Prozent der Studierenden an deutschen Universitäten eine Einwanderungsgeschichte – doch das war nicht immer der Fall. Mehrere Studien belegen, dass Kinder mit sogenanntem Migrationshintergrund stärker sozialen und finanziellen Risiken ausgesetzt sind und öfter aus bildungsfernen Familien stammen. Viele Studierende mit Migrationshintergrund sind somit im Zusammenhang von Bildungserfolg und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen klassische Bildungsaufsteiger:innen. Doch wie war der Weg für diese Bildungsaufsteiger:innen tatsächlich, und gibt es Unterschiede in den zwei Generationen der Gastarbeiter:innenkinder?
Im Laufe meines Studiums habe mich öfters gefragt, wie es für die Gastarbeiter:innenkinder damals gewesen ist, ob sie auch die gleichen Schwierigkeiten hatten wie ich oder ob ihnen das Studium sogar noch schwerer fiel. Dafür habe ich drei Kinder von Gastarbeiter:innen zu einem Onlinegespräch eingeladen. Mehmet (45) habe ich vor drei Jahren in einer Ringvorlesung als Gastdozent zum Thema „Bildungschancen von Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte“ kennengelernt. Bejna (30) und Elif (24) kennen sich durch die Arbeit in einer interkulturellen Bildungseinrichtung.

Weil seit der Coronapandemie immer mehr unserer Begegnungen online stattfinden, treffe ich auch diese drei bemerkenswerten Menschen in einem Zoom-Meeting. Während der Stunden, die wir mit dem Reden verbringen, verschwinden die Euphorie und Neugier nie ganz. Auf dem Bildschirm sind vier Kacheln in einem Raster: oben links sehen wir Mehmet, wie er es sich vor dem Laptop mit einem Glas Çay (türkisch: Tee) und mit einem Stapel Büchern auf dem Tisch gemütlich gemacht hat. Bejna ist in der Kachel rechts von ihm mit einer Tasse Kaffee und einem Teller mit Tulumbe (bosnisches Brandteiggebäck) zu sehen. Elif, die gerade aus der Arbeit gekommen ist, sitzt mit einem Teller veganer Mantı (türkische Teigtaschen) vor der Kamera und hört uns aufmerksam zu.
Relativ schnell fangen wir an, über Geld zu reden, denn bis heute ist Studieren für Menschen aus einem Haushalt mit niedrigem sozioökonomischen Status eine Herausforderung. Gut zehn Jahre sind vergangen, als in NRW die Studiengebühren komplett abgeschafft wurden. Mehmet, 45 Jahre alt und der älteste Sohn türkischer Gastarbeiter:innen, hat damals als Erster in seiner Familie studiert und ist nun Mathe- und Physiklehrer an einer Gesamtschule.
Wenn er sich an die Studienkosten von damals erinnert, sagt er etwas verärgert, aber trotzdem lächelnd: „Ich bin vermutlich in der falschen Zeit auf die Welt gekommen. Wir hatten damals nicht so viel Unterstützung vom Staat und anderen Einrichtungen bekommen. Ich musste damals in zwei Jobs arbeiten, damit ich mit den Studienkosten und dem Lebensunterhalt über die Runden kam.“ Zwar gab es zu Studienzeiten um die Jahrhundertwende BAföG, jedoch erfuhr er viel zu spät davon, und ihm wurde auch keine Unterstützung seitens der Universität angeboten. Als Kind einer Gastarbeiter:innenfamilie war er es schon seit den ersten Schuljahren gewohnt, im Lebensmittelladen des Vaters auszuhelfen. Aber mit den steigenden Anforderungen auf dem Gymnasium und später im Studium musste sich Mehmet eine Beschäftigung übers Wochenende suchen. Nur so konnte er sich seine Lernmaterialien und technische Ausstattung leisten. Elif, die getrennte Eltern und keinen Kontakt zum Vater hat, versteht Mehmets Probleme: Immer wieder gab es Probleme mit dem BAföG-Amt, bis sie sich dazu entschied, ihr Lehramtsstudium selbst zu finanzieren.
Bejna hat sich als Tochter bosnischer Gastarbeiter:innenkinder für ein Chemie- und Mathematikstudium entschieden. Sie kann sich noch ganz genau erinnern, wie sehr sie sich gefreut hatte, als sie im Abitur mitbekam, dass die Studienkosten in NRW 2010/11 endgültig abgeschafft werden sollten. Bejna hatte keine finanziellen Engpässe, jedoch sprachliche Schwierigkeiten in der Schule, weshalb sie sich für ein naturwissenschaftliches Studium an der Universität entschieden hat. „Ich habe mich nicht immer so gut mit meinen Lehrer:innen verstanden. Auch im Chemie- und Mathematikstudium habe ich gemerkt, dass es an der Kommunikation hapert – aber diesmal nicht wegen der Sprache, sondern wegen eines Stücks Tuch um meinen Kopf. Ständig wurde ich gefragt, ob ich ja auch alles gut verstehe. Als ob ein Stück Tuch plötzlich mein Hörvermögen beeinträchtigen würde“, sagt sie in einem genervten Ton und verdreht dabei die Augen.
Ungleichbehandelt
Das Gespräch entwickelt sich schnell in Richtung Rassismus: Elif kann die beiden sehr gut verstehen. Zwar trägt sie kein Kopftuch, aber anhand ihres Namens erkennt man schon, dass sie nicht deutsch gelesen wird. Das führte immer wieder zu Konflikten in der Schule und im Studium. Genauso wie Bejna ist sie empört über die Vorurteile gegenüber muslimischen Frauen, sei es in der Mehrheitsgesellschaft oder in der muslimischen Community. „Wir leben im Jahr 2021, und man müsste annehmen, dass sich Deutschland mit dem Islam und der muslimischen Frau angefreundet hat, jedoch scheint Gegenteiliges der Fall zu sein [Anmerkung der Redaktion: Dieser Text erschien zum ersten Mal 2021 im Magazin „Rauschen“ der Jungen Islam Konferenz Medienakademie.]. Ich konnte es nicht fassen, wie wir es ernsthaft gesamtgesellschaftlich geschafft haben, ein Gesetz zuzulassen, das Beamt:innen verbietet, ein Kopftuch zu tragen.“ Elif ist wütend. Sie meint das Neutralitätsgesetz, das unter anderem in Berlin religiöse Symbole im öffentlichen Dienst verbietet. Für Elif ist das Gesetz ein gewaltiger Schritt zurück in der postmigrantischen Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der DiversitätDiversity ist ein englischer Begriff und wird im Deutschen mit „Diversität“ übersetzt. Es geht dabei um den bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. als Selbstverständlichkeit gelebt wird. Zugleich reagiert ein Teil der Gesellschaft aber auf die verstärkte Sichtbarkeit von Migrant:innenkindern mit immer engeren Vorstellungen davon, was deutsch sein soll. Sie kann nicht begreifen, warum ständig definiert wird, wer deutsch ist und wer nicht „Wir kennen es ja: in der Türkei ‚Almancı‘ und in Deutschland ‚die Migrant:innen‘ – wir sind die Grenzgänger:innen zwischen den beiden Welten“, dabei schüttelt sie ihren Kopf und trinkt einen Schluck Wasser.
»Wir sind die Grenzgänger:innen zwischen den beiden Welten.«

»Wir sind Kinder von Menschen, die für uns eine bessere Zukunft erträumt haben. Nun ist es Zeit, für diese Zukunft mitanzupacken und gesellschaftliche Normen neu zu überdenken.«
Mehmet, der zunächst still war und sich wieder ins Gespräch einklinkt, gibt zu, dass er häufiger bei seinem Sohn merkt, wie divers sein Freundeskreis ist. Unterschiedliche kulturelle oder ethnische Hintergründe spielen bei der Auswahl seiner Freund:innen keine Rolle. Zwar war das in seiner Jugend ähnlich, aber trotz allem blieben die „Migrant:innenkinder“ eher unter sich und die deutschen Kinder ebenso. Er ist froh, dass in der postmigrantischen Gesellschaft und mit den nachkommenden Generationen DiversitätDiversity ist ein englischer Begriff und wird im Deutschen mit „Diversität“ übersetzt. Es geht dabei um den bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. gelebt wird und man sich nicht mehr durch Differenzen ausschließen lässt: „Wir sind Kinder von Menschen, die für uns eine bessere Zukunft erträumt haben. Nun ist es Zeit, für diese Zukunft mitanzupacken und gesellschaftliche Normen neu zu überdenken.“
Ich frage in die Runde, wie man das am besten umsetzen kann, Elif antwortet, dass immer mehr Institutionen eine interkulturelle Öffnung erleben. Auch gibt es an einigen Universitäten, genauso wie an ihrer eigenen, mittlerweile ein BIPoC-Referat, wo sie sich neben ihrem Studium engagiert. „Wir müssen nicht nur Orte der Begegnung und Dialoge schaffen, sondern uns für eine rassismuskritische Universität einsetzen. Wie auch die Forscherin Kimberlé Crenshaw sagt: ‚Und wir alle wissen, dass man ein Problem, für das es keinen Namen gibt, nicht sehen kann, und wenn man ein Problem nicht sieht, kann man es auch nicht lösen.‘“ Mittlerweile gebe es viele Antidiskriminierungsstellen, sei es für die Arbeit, das Studium, die Schule oder im Alltag. Leider würden jedoch viele Fälle von Diskriminierung nicht gemeldet und können somit nicht in der Statistik aufgenommen werden. „Aber wenn wir die Fälle benennen und melden würden, könnten wir gesamtgesellschaftlich bessere Lösungsansätze und Bildungsmaßnahmen fördern“, sagt Elif.
Unangepasst
Mehmet hat seinen Çay schon längst ausgetrunken und fügt hinzu, dass eigentlich schon genug Fälle gemeldet, genug Geschichten und Schicksalsschläge erzählt wurden, wenn es der Politik jedoch nicht passen würde, werden diese Fälle und Geschichten gerne mal ignoriert. „Meiner Meinung nach ist es wichtig, mehr BIPoC-Menschen in den Führungspositionen zu haben, die auch Entscheidungskompetenzen haben. Aber ich glaube, dass das mit der dritten und vierten Generation von Gastarbeiter:innen tatsächlich passieren wird und bereits passiert. Damals hatten wir uns nicht so stark für unsere Rechte eingesetzt. Wir waren dankbar genug, dass wir überhaupt die Chance auf eine bessere Zukunft bekommen haben. Dennoch darf man vor den heutigen Problemen in der Gesellschaft und Politik nicht die Augen verschließen.“
Hier sind die drei sich einig. Bejna fügt hinzu: „Dieses Argument hat nun mit Verspätung seinen Weg an die Universitäten gefunden, was sich in einer immer lauter werdenden Diskussion über die Verantwortung in den Plattformen für höhere Bildung zeigt.“ Sie erzählt, dass die Studierenden damals hart für einen Gebetsraum oder gar einen Raum der Stille an den Unis kämpfen mussten. Das überrascht mich nicht, um ehrlich zu sein. Trotzdem hat Bejna eine Vision für die nachkommenden Generationen: „Ich erhoffe mir einfach, dass sich die Universitäten nicht an politische Debatten und Diskurse anpassen, sondern tatsächlich ein Ort für Begegnung, Innovation und Weiterentwicklung bleiben. Wenn wir in der Forschung die richtigen Fragen stellen, können wir auch bessere Antworten und Konzepte entwickeln.“

Wenn ich den dreien zuhöre, wird mir bewusst, warum ich mich für ein Studium als Erziehungswissenschaftlerin entschieden habe: Ich bin überzeugt davon, dass individuelle Bildung zu einer gesellschaftlichen Entwicklung führt. Wir als sogenannte Grenzgänger:innen können Begegnungen zwischen Einzelnen und sozialen Gruppen herstellen und durch das offen gestaltete Miteinander Horizonte erweitern und demokratische Entwicklungen fördern. Mehmet, Bejna und Elif machen das schon – es ist Zeit, dass jede:r anpackt!

fürs DEMOS MAG
Du willst das DEMOS MAG unterstützen, weil guter, diverser Journalismus Dir am Herzen liegt und Du auch denkst, dass Demokratie keine Selbstläuferin ist? Dann spende einmalig mit einer eSpende oder werde Abonnent:in auf Steady.
Fördere mit uns den gesellschaftlichen Diskurs und gib mit Deiner Spende den im Mainstream unterrepräsentierten Stimmen mehr Gewicht.