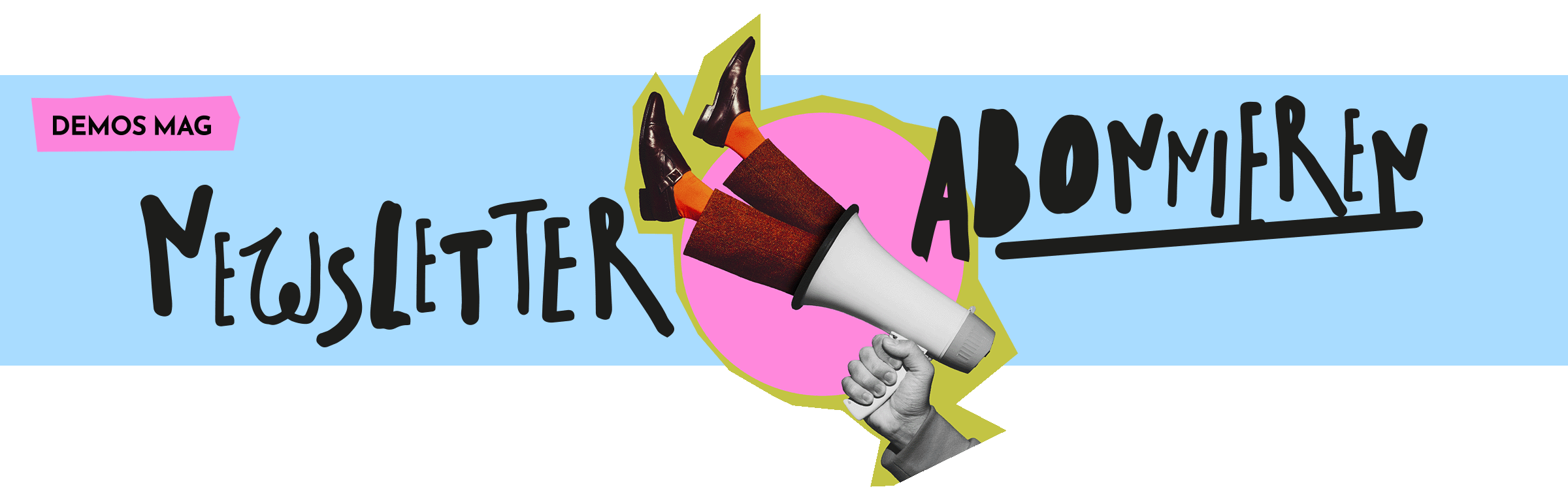Platz machen!
Privilegierte Menschen müssen einen Schritt weiter gehen.
Wenn Menschen, die selbst nicht davon betroffen sind, sich mit Diskriminierung beschäftigen, tun sie das oft, indem sie sich um Verständnis dessen bemühen, was Diskriminierung genau ist und wie sie vonstatten geht, insbesondere auf struktureller Ebene. Meist setzen sich diese Menschen dann auch mit den eigenen Privilegien auseinander und damit, was ihnen durch diese Privilegien möglich wurde. Mirrianne Mahn (Stadtverordnete Frankfurt am Main, Referentin für Diversitätsentwicklung) findet: Das reicht nicht. Privilegierte Menschen müssen unbedingt einen Schritt weitergehen und aktiv Platz machen für die, die nach wie vor marginalisiert sind und denen Zugänge verwehrt werden.
Wir sind hier
Es ist bereits kurz nach zwanzig Uhr, als Dunja Hayali gemeinsam mit Mirrianne Mahn, Aladin El-Mafaalani und Hasnain Kazim die Bühne des Lesesaals im Literaturhaus Frankfurt betritt. Nachdem alle Platz genommen haben, schaut sich Hayali lächelnd um und spricht aus, was ich und wohl auch viele andere im Raum empfinden in diesem Moment, geprägt durch die Event-Abstinenz der Pandemie: „Echte Menschen!“
Die Veranstaltung im Literaturhaus Frankfurt ist der Auftakt des dreitägigen Festivals „Wir sind hier“ in Gedenken an die Opfer der rassistischen Morde vom 19. Februar 2020 in Hanau. Es geht um das Erinnern, es geht jedoch auch um die Frage, wo wir stehen in der Aufarbeitung dessen, was rassistische Gewalt und Anschläge wie diesen überhaupt möglich gemacht hat und auch nach wie vor macht. Die Antwort auf diese Frage ist alles andere als beruhigend. Für mich selbst ist das immer wieder eine sehr bittere Erkenntnis, insbesondere dann, wenn ich bedenke, dass weite Teile der Beschreibung von Strukturen rechten Terrors nichts Neues sind. Ich selbst habe mich vor ziemlich genau zwanzig Jahren in der Abschlussarbeit meines politikwissenschaftlichen Studiums unter anderem mit der Vernetzung der europäischen Rechten beschäftigt. Seither ist viel passiert, geändert hat sich indes am konkreten Umgang damit wenig.
Was sich durchaus weiterentwickelt hat, ist der Erkenntnisprozess, vor allem der akademische. Der Osnabrücker Professor Aladin El-Mafaalani reagierte kürzlich mit einem medialen Lächeln darauf, als ich ihn mit einem Posting in den sozialen Medien wissen ließ, dass ihm die sprichwörtlichen Ohren vermutlich deshalb in letzter Zeit so häufig klingeln, weil ich den von ihm geprägten Begriff „Diskriminierungs-Paradox“ inzwischen in jedem Training und Workshop nutze, das oder den ich zum Bereich Diskriminierung in Organisationen durchführe. Während man mit Blick auf den Erkenntnisprozess und das Transparentmachen von Rassismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus durchaus eine deutliche Veränderung feststellen könne, sagt er an diesem Abend im Frankfurter Literaturhaus, habe sich in der Frage der institutionellen und strukturellen Bedingungen noch sehr wenig getan. An Lösungsideen indes mangelt es nicht, wie er ausführt. Das besagte Diskriminierungs-Paradox ist eine der Kernthesen seines aktuellen Buchs „Wozu Rassismus?“ und meint: Gerade weil für uns Diskriminierung in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Kommunikation so sehr präsent ist, kann dies als Zeichen dafür gewertet werden, dass es weniger Diskriminierung gibt. Denn nur weil marginalisierte Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind, inzwischen Teil des Diskurses sind und, so El-Mafaalanis Bild, aktiv mit am Tisch sitzen und mitreden, komme es uns so vor, als sei Diskriminierung ein viel größeres Thema geworden: Wir setzen die Sichtbarkeit des Themas mit einer Zunahme der Diskriminierungsfälle gleich. El-Mafaalani stellt jedoch klar, dass die Anzahl beispielsweise an Übergriffen in den letzten Jahrzehnten nicht substanziell gestiegen sei, Berichte darüber seien jedoch, nicht zuletzt durch die sozialen Medien, deutlich präsenter.


Institutioneller Rassismus
Dass sich institutionell wenig getan hat, ist auch im Rahmen des aktuellen NSU 2.0-Prozesses zu beobachten, in dem einmal mehr die Einzeltäterthese im Vordergrund steht. In einem Interview mit der ZEIT vom 18. Februar 2022 stellt Anwältin Seda Başay-Yildiz, eine der vom NSU 2.0 bedrohten Personen, heraus, welche Veränderungen beispielsweise innerhalb der Polizei sie fordert: „Wir haben ein massives Rassismusproblem auch in den Sicherheitsbehörden, nur wollen die das selbst nicht zugeben oder erkennen. Fast alles, was aus diesem Bereich in der Vergangenheit bekannt wurde, kam durch Zufall raus. (…) Die Polizei hat eine wichtige Funktion in diesem Land. Der Schutz von Minderheiten lässt sich mit einer rassistischen Ideologie nicht vereinbaren. An wen soll man sich als Bürger mit Migrationshintergrund denn sonst überhaupt noch wenden? Die Polizei hat frei von Extremismus zu sein.“
Es fühlt sich für mich ganz eigenartig an, Sedas Worte zu zitieren und so über sie zu schreiben, als würden wir uns nicht seit Jahrzehnten kennen. Die heute bekannte Anwältin, die unter anderem eine der Nebenklagevertreterinnen im NSU-Prozess war und die vom NSU 2.0 mit dem Tode bedroht wurde, war einst meine Schulkameradin. Zwar haben wir uns in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten seit dem Abitur nur selten gesehen, blieben aber über die sozialen Medien in Kontakt, und wenngleich ich als studierte Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus ohnehin nahe am Thema war und bin, erhielt dies im negativsten Sinne des Wortes mit der Bedrohung Sedas noch einmal eine ganz andere Qualität für mich: Es wurde persönlich.

„Check your privilege“ reicht nicht
Nun kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass es nicht so persönlich wurde und vermutlich auch nie wird, dass ich selbst von Bedrohung betroffen war, bin oder es künftig sein werde. Aber es macht mich an diesem Abend im Literaturhaus Frankfurt, als zwar Sedas Name nicht explizit genannt, die Drohungen gegen sie aber erwähnt werden, besonders nachdenklich. Noch nachdenklicher werde ich bei einem der Statements von Mirrianne Mahn, die unter anderem dadurch einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, dass sie bei der Buchmesse 2021 die Festakt-Rede des Frankfurter Bürgermeisters Peter Feldmann in der Paulskirche unterbrach und einen flammenden Appell an die Zuhörenden richtete bezüglich der bedrohlichen Situation Schwarzer Autorinnen durch die Präsenz und Agitation rechter Verlage auf der Buchmesse.
An diesem Abend im Literaturhaus Frankfurt sagt Mahn, gerichtet an Privilegierte, zu denen ich ganz sicher zähle, dass es wunderbar sei, wenn wir uns damit beschäftigten, was es zum Thema Rassismus zu lernen gibt, wenn wir Wissen dazu weitertrügen, wenn wir uns unserer eigenen Privilegien bewusst würden – doch dass das nicht ausreiche. „Macht Platz“, fordert sie uns auf, Platz für marginalisierte, diskriminierte Menschen. Platz machen sollen wir, damit Personen, denen dieser bisher versperrt ist, tatsächlich Zugang erhalten. Zugang zu Aufträgen und Projekten, Zugang zu Positionen, Zugang eben nicht nur zu dem Diskurs-Tisch, von dem Aladin El-Mafaalani spricht. Explizit fordert Mahn: Wann immer eine privilegierte Person mit einer Gelegenheit konfrontiert sei, solle sie überlegen, ob sie nicht Platz machen und diese einer marginalisierten Person überlassen könne.
Wir müssen Platz machen
Dieser Gedanke wird mich den ganzen Abend, den darauffolgenden Samstag und auch an den weiteren Tagen nie ganz loslassen. Ich nehme wahr, wie es mehrere dazu widerstreitende Anteile in mir gibt, die in einen Dialog miteinander einsteigen, der sich ungefähr so anhört:
„Heißt das, ich soll bei jeder Projektanfrage künftig die auftraggebende Person aktiv danach fragen, ob nicht eine von Marginalisierung betroffene Person das besser machen kann?“ – „Nein, nicht besser – ob es eine marginalisierte Person machen kann!“ – „Aber was ist, wenn ich dann selbst kaum noch Aufträge habe?“ – „Ja, willkommen im Leben! Stell dir vor, Menschen, die diskriminiert werden, haben genau diesen Struggle Tag für Tag!“ – „Aber ich mache doch schon einiges! Ich kenne mich ganz gut aus mit dem Kontext. Ich gebe Antidiskriminierungstrainings, ich erhebe meine Stimme, ich arbeite ehrenamtlich und mache Pro-bono-Projekte, ich bin als Mentorin in zwei Organisationen aktiv, die marginalisierte Gruppen unterstützen.“ – „Ja – und meinst du, dass das wirklich ausreicht?“
Nachdem ich den ersten Entwurf dieses Textes geschrieben habe, gehe ich mit zwei Personen in meinem Umfeld dazu in Resonanz. Mich interessieren ihre Gedanken dazu, mich interessiert, welche Fragen mein Text bei ihnen aufwirft. Daraus entsteht unter anderem ein weiterer zentraler Gedanke: Was es unbedingt braucht, wenn Privilegierte Platz machen, ist, dass Marginalisierte diesen Platz auch einnehmen. Das mag nach Wollen oder Können klingen, vor allem ist damit jedoch Dürfen gemeint, also: Verändern wir die Strukturen so mit, dass Chancen auch genutzt werden dürfen und dass dies in hinreichend großem Rahmen geschehen kann? Ein Beispiel dafür ist die nach wie vor vieldiskutierte Frauenquote. An anderer Stelle habe ich dazu bereits geschrieben, was meine Position ist: Ich wünschte, wir bräuchten keine Quotenregelung; wenn es aber darum geht, ein Mindestmaß an Vertretung marginalisierter Gruppen zu schaffen, kommen wir nicht umhin, das strukturell zu regeln. Im Rahmen des „Platz machen“-Gedankens bedeutet das also, dass dieser auch strukturell unterstützt werden muss, damit der Platz auch genommen werden darf.
Zurück zu mir und der Frage, wo ich zwischenzeitlich in meiner eigenen Auseinandersetzung angekommen bin. Ja, ich mache schon einiges, und vermutlich bin ich mir an manchen Stellen meiner Privilegien bewusster als andere Personen, eben weil ich mich beruflich mit dem Thema auseinandersetze, und das in unterschiedlichen Arten und Weisen seit vielen Jahren. Dennoch darf ich und dürfen wir alle, die wir privilegiert sind, die wir in Sicherheit leben können und nicht um die nächste Mahlzeit fürchten müssen, deren Leben nicht bedroht ist, die wir ohne Angst vor Gewalt eine Straße entlanggehen können, ohne uns ständig umzudrehen, wir alle dürfen nicht aufhören, uns damit auseinanderzusetzen und zu fragen, was wir noch tun können, um Platz zu machen. Solange bis der Tisch groß genug für Alle ist.

fürs DEMOS MAG
Du willst das DEMOS MAG unterstützen, weil guter, diverser Journalismus Dir am Herzen liegt und Du auch denkst, dass Demokratie keine Selbstläuferin ist? Dann spende einmalig mit einer eSpende oder werde Abonnent:in auf Steady.
Fördere mit uns den gesellschaftlichen Diskurs und gib mit Deiner Spende den im Mainstream unterrepräsentierten Stimmen mehr Gewicht.