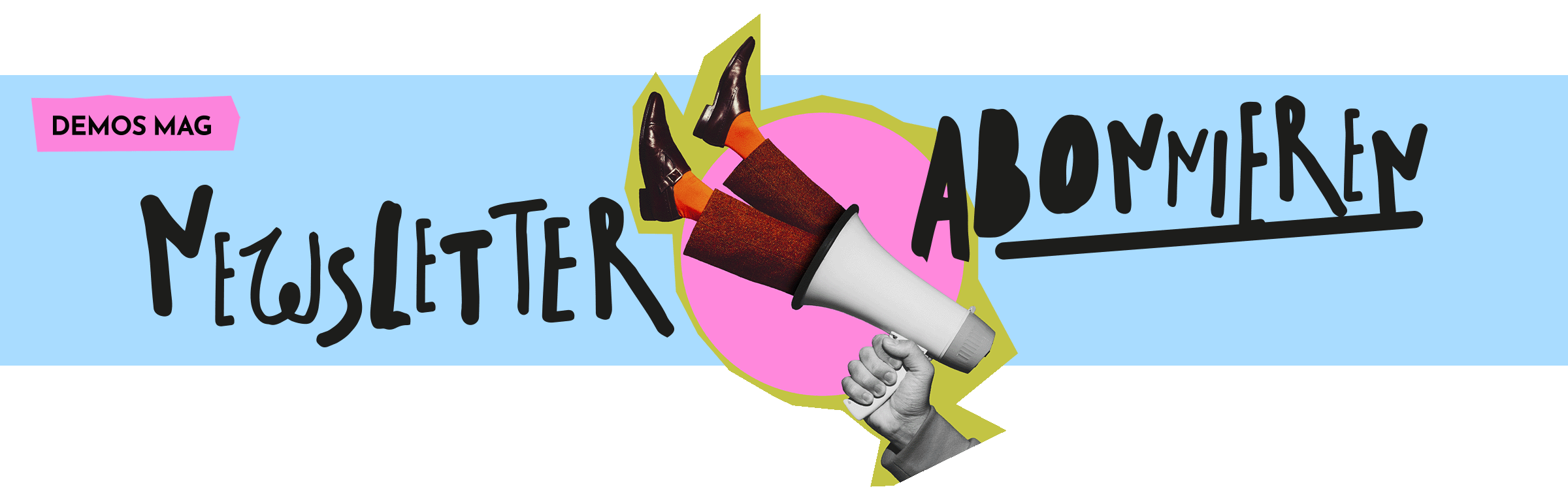„Wir müssen den Begriff Aktivist:in stolz tragen.“
Für die demokratische Debattenkultur in Deutschland ist Emilia Roig ein Segen.
Emilia Roig ist Politologin und Aktivistin mit den Themenschwerpunkten IntersektionalitätDas Verwobensein verschiedener Merkmale, die eine Person ihr Eigen nennt und derentwegen sie ggf. Diskriminierung erfährt und Antidiskriminierung. Sie lebt seit 2005 in Berlin, wo sie das „Center for Intersectional Justice“ e. V. gegründet hat. Ich kenne nur wenige Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und so solidarisch sind wie sie. Emilia achtet darauf, für verschiedene marginalisierte Gruppen gleichzeitig zu argumentieren und die Arbeit anderer zu würdigen. Sie denkt strategisch und vorausschauend. In Interviews lenkt sie den Fokus immer wieder auf Menschen, die in Bewegungen aktiv sind oder diese Themen schon lange bearbeiten. Und Emilia hat eine Superkraft: Sie bleibt bei Provokationen und unterirdischen Debatten ruhig und sachlich, konsequent und stark. Für die demokratische Debattenkultur in Deutschland ist sie ein Segen.
Wir verabreden uns zum Kaffee. Weil sie eigentlich keine Zeit hat, geht es nur per Videochat.
Ferda Ataman: Liebe Emilia, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Du bist ja wirklich schwer zu kriegen. Kann es sein, dass deine Themen gerade sehr en vogue sind?
Emilia Roig: Ja, ich glaube schon. Wobei mich der Begriff etwas stört. Es sollte keine Mode sein, sich mit Rassismus und Antisemitismus zu beschäftigen. Das darf nicht oberflächlich bleiben, sondern sollte immer Substanz haben. Aber in der Tat gibt es gerade eine Bereitschaft, sich mit den wichtigen und teilweise schwierigen Fragen stärker auseinanderzusetzen.
Wie erklärst du dir das?
Ich habe das Gefühl, dass es einen kollektiven Erwachungsprozess gibt. George Floyd und die Welle des Widerstands danach zeigen, dass Menschen sich nicht mehr mit einseitigen Narrativen zufriedengeben. Deswegen sind Stimmen wie unsere, die marginalisierte Gruppen und Perspektiven repräsentieren, gerade gefragt.
Das beschreibst du in deinem Buch „Why we matter“ sehr gut.
Aktivismus geht mit Expertise einher und umgekehrt ist Expertise eigentlich immer auch ideologisch.

Du bist ja gleichzeitig vieles: Du bist Politologin, Expertin und Autorin und du selbst bezeichnest dich auch als Aktivistin. Das Attribut „Aktivist:in“ wird aber oft gegen das Expert:innentum ausgespielt. Als könne man nur Expertin oder Aktivistin sein. Aktivismus wird von manchen offenbar als ideologisch und nicht rational verstanden. Wie siehst du das?
Mir ist aufgefallen, dass mir in letzter Zeit meine anderen Titel abgesprochen werden und ich auf den Aktivismus reduziert werde. Ich will diesen Begriff aber nicht abwerten und aufhören, mich so zu nennen. Die Welt kommt voran, dank Aktivist:innen. Also thematisiere ich das: Aktivismus geht mit Expertise einher und umgekehrt ist Expertise eigentlich immer auch ideologisch. Es gibt keine objektive, neutrale Expertise, die nirgendwo verortet ist und keinen politischen Hintergrund hat. Selbst medizinische Forschung kann politisch sein, ohne dass wir das merken, zum Beispiel, wenn sie hauptsächlich vom männlichen Körper ausgeht.
Ein großes Problem sehe ich im deutschen Diskurs selbst, in der Art und Weise, wie öffentliche Debatten geführt werden.
Bräuchten wir dann mal eine Offensive zur Ehrenrettung des Aktivismus, um demokratische Arbeit in Deutschland zu erleichtern?
Ja, wir müssen diesen Begriff stolz tragen und dürfen uns nicht davon distanzieren. Wir sollten nicht zulassen, dass Aktivismus diskreditiert und delegitimiert wird.
Du hast in Frankreich, Deutschland, Tansania, Uganda und Kambodscha gelebt, in Lyon, London, New York, Berlin gelernt und gelehrt. Dein großes Thema sind der Abbau von Diskriminierung und der Aufbau von effektiven Strategien gegen Ungleichheit und Rassismus. Wo siehst du in Deutschland die größten Probleme?
Ich würde es lieber Kampf gegen Unterdrückung nennen, denn Diskriminierung ist nur eine Erscheinungsform von Unterdrückung. Die Probleme hierbei sind vielschichtig. Das Erste ist der Mangel an Problembewusstsein. Es fehlt das Zugeständnis, dass es in Deutschland Unterdrückung gibt. Dabei gibt es sie natürlich, wir haben dafür Zahlen und Fakten.
Ein großes Problem sehe ich im deutschen Diskurs selbst, in der Art und Weise, wie öffentliche Debatten geführt werden. Das ist fast immer gekennzeichnet von Gaslighting. Das heißt, wenn Menschen wie wir versuchen, über Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung zu sprechen, wird erstmal in Frage gestellt, ob es das überhaupt so gibt. Dann holt man einen weißen Experten, der das Gegenteil denkt. Nachdem Leute wie wir dazu geforscht, gelesen, studiert und Erfahrungen gesammelt haben, sollen wir auf Augenhöhe mit Leuten diskutieren, die nichts dazu gelesen, studiert oder erfahren haben, aber eine Meinung dazu mitbringen. Dann sollst du dich gegenüber dieser Person behaupten und das Publikum darf entscheiden, ob es ein Problem mit Rassismus gibt oder nicht. Das ist auch eine Form von Gewalt.
Neben der diskursiven Ebene gibt es noch andere: Armut und physische Gewalt zum Beispiel. Nicht nur durch Neonazis, auch durch die Polizei und den Staat erleben Menschen Gewalt, wie bei illegalen Pushbacks. Außerdem gibt es Ausschlüsse bei Wahlen, im Umgang mit Sprachen und … Es gibt wirklich viele Probleme. Ich selbst beschäftige mich am meisten mit der diskursiven Ebene. Es gibt aber zum Glück viele wichtige NGOs, die gegen die materiellen und physischen Probleme arbeiten.
In Deutschland fehlt ja bis heute die Einsicht, ein klassisches Einwanderungsland zu sein. Viele glauben immer noch, dass Migration die Ausnahme ist und nicht der Normalzustand. Was tun gegen diese „deutsche Bewusstseinsstörung“, wie ich das nenne?
Ich würde das nicht Störung nennen, denn Störung würde bedeuten, dass Leute nichts dafür können und dass man das entschuldigen kann. Ich sehe das eher als eine Art der Machtausübung. Das Verneinen und Verleugnen von Erfahrungen und Wissen über Ausbeutung und Rassismus ist eine bewusste Entscheidung. Damit wird gesagt, eure Meinungen und eure Erfahrungen bedeuten nichts. Dagegen klingt Störung für mich nach etwas, bei dem man helfen will.
Um ehrlich zu sein, ich will auch helfen. Ich habe das Gefühl, dass Deutschland bei diesem Thema Hilfe braucht. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt, dass man es nicht pathologisieren soll, und ich sehe auch die Gefahr von Ableismus in solchen Begriffen.
Wir können ja verschiedene Begriffe diskutieren, aber vielleicht sollten wir schnell an den Punkt kommen und erklären, dass es keine Störung ist und nicht entschuldbar.


Wir können nicht davon ausgehen, dass, wenn wir nur das Patriarchat bekämpfen, Kapitalismus und Rassismus automatisch geschwächt werden.
Du hast 2017 das „Center for Intersectional Justice“ gegründet und forderst, dass Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit von Anfang an intersektional passiert. Auch in deinem Buch betonst du, dass Diskriminierungsmerkmale nicht einzeln oder nacheinander angegangen werden sollen. Warum?
Diskriminierung passiert nie nur auf einer einzigen Achse, wie der Achse Geschlecht, oder Migration oder Hautfarbe oder Behinderung. Alle Unterdrückungsformen und Ungleichheitsformen werden durch das Zusammenwirken von drei großen Unterdrückungssystemen produziert: Rassismus, Patriarchat und Kapitalismus. Wir können nicht davon ausgehen, dass, wenn wir nur das Patriarchat bekämpfen, Kapitalismus und Rassismus automatisch geschwächt werden. So läuft das nicht. IntersektionalitätDas Verwobensein verschiedener Merkmale, die eine Person ihr Eigen nennt und derentwegen sie ggf. Diskriminierung erfährt heißt, wir müssen diese drei Systeme als ein Phänomen betrachten und gemeinsam angehen.
Da stimme ich zu. Trotzdem hat mich der Begriff „intersektional“ anfangs abgeschreckt, weil er schwer greifbar ist. Funktioniert er oder ist er nicht vielleicht eine intellektuelle Überforderung?
Ich würde auf keinen Fall sagen, dass der Begriff eine intellektuelle Überforderung ist. Aber selbst wenn, steht es uns frei, mit Begriffen zu machen, was wir wollen. Es gibt viel, was gegen „intersektional“ angebracht wird: der Begriff sei zu akademisch, zu elitär, nicht in Deutschland anwendbar, weil aus den USA und so weiter. Dabei heißt IntersektionalitätDas Verwobensein verschiedener Merkmale, die eine Person ihr Eigen nennt und derentwegen sie ggf. Diskriminierung erfährt nichts anderes, als Unterdrückung in seiner Gesamtheit zu bekämpfen. Punkt. Wollen wir Diskriminierung nur oberflächlich bekämpfen, geht es auch ohne. Sonst geht es nur intersektional.
Womit beschäftigst du dich am liebsten?
Schreiben. Alleine. In Ruhe. Und ohne Zeitdruck (lacht). Inhaltlich beschäftige ich mich am liebsten mit der Verschränkung von Spiritualität und sozialer Gerechtigkeit.
Was meinst du damit?
Spiritualität wird in unserer Gesellschaft oft als rückständig und naiv betrachtet, weil sie im Kolonialismus als unzivilisiert deklassiert wurde. Indigenes Wissen und indigene Praktiken wurden unterdrückt. Decolonial spiritual reality bedeutet, sich diese Praktiken wieder anzueignen, ohne „white washing“. Nelson Mandela, Gandhi, Rosa Parks, alle hatten auch eine spirituelle Seite. Das wird oft ausgeblendet. Ich glaube, wir können nicht irgendwo ankommen, wenn wir nicht an uns arbeiten. Nur mit kognitiven Handlungen können wir Gerechtigkeit nicht erreichen. Kollektive Veränderung braucht spirituelles Zusammenkommen. Das klingt jetzt abstrakt, tut mir leid.
Hast du ein Beispiel?
Meine Mutter kommt aus Martinique, unsere Familie ist sehr geprägt von Spiritualität. Mein Onkel legt uns immer die Tarot-Karten, wenn etwas entschieden werden musste. Meine Urgroßmutter hatte seherische Fähigkeiten. Ich habe mich früher dafür geschämt, jetzt tue ich das nicht mehr. Ich merke, wie wichtig das ist.
Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf, dass es das bei uns in der Türkei auch gab. Es wurde aus dem Kaffeesatz gelesen, Träume gedeutet, mit den Vorfahren gesprochen …
Genau das. Mir ist übrigens auch Verlangsamung wichtig. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, weil ich so viel Stress habe. Aber mich beschäftigt, wie wir unseren Alltag gestalten können, so dass er Kapitalismus schwächt.
Das klingt vielversprechend. Darüber reden wir dann hoffentlich beim nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Emilia!

fürs DEMOS MAG
Du willst das DEMOS MAG unterstützen, weil guter, diverser Journalismus Dir am Herzen liegt und Du auch denkst, dass Demokratie keine Selbstläuferin ist? Dann spende einmalig mit einer eSpende oder werde Abonnent:in auf Steady.
Fördere mit uns den gesellschaftlichen Diskurs und gib mit Deiner Spende den im Mainstream unterrepräsentierten Stimmen mehr Gewicht.