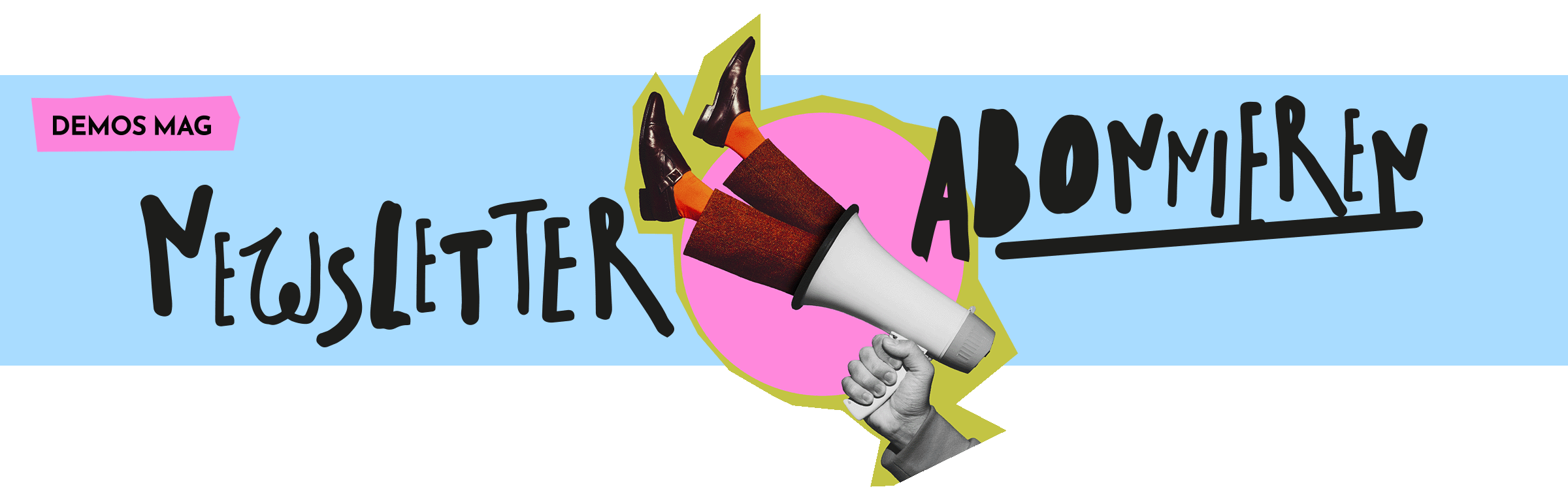Nie angekommen
Warum Festreden keine echte Würdigung ersetzen
In den 1960er- und 1970er-Jahren kamen Gastarbeiter:innen aus dem Ausland nach Deutschland, um hier zu arbeiten und das Land aufzubauen – für den Wohlstand, den wir heute genießen. Doch was sie zurückbekamen, ist keine Würdigung, sondern nur ein leeres Lippenbekenntnis.
Es ist 1970. Eine junge 30-jährige Frau aus einem armen alevitisch-kurdischen Dorf im Südosten der Türkei macht sich auf den Weg Richtung Westen. Erst nach Istanbul, um dort medizinisch durchgecheckt zu werden. Danach, wenn alles gut läuft, inşallah, in das 3.000 Kilometer entfernte Deutschland. Sie lässt nicht nur ihre Eltern und Geschwister zurück, sondern auch ihren Ehemann und ihre drei Töchter. Die jüngste von ihnen ist noch im Säuglingsalter. Hätte sie damals gewusst, dass sie diese Tochter nie wieder sehen wird, wäre sie wahrscheinlich nicht in den Flieger nach München gestiegen.
„Hätte sie damals gewusst, dass sie diese Tochter nie wieder sehen wird, wäre sie wahrscheinlich nicht in den Flieger nach München gestiegen.“
Das ist die Geschichte meiner Oma, die 1970 als Gastarbeiterin aus der Türkei nach Deutschland gerufen wurde. So ähnlich können viele junge Menschen in Deutschland, die einen familiären Bezug in die Türkei haben, die Geschichten ihrer Eltern oder Großeltern nacherzählen. Die junge Bundesrepublik brauchte nach dem Krieg Arbeitskräfte – und zwar für etliche Berufe, für die es in der deutschen Bevölkerung nicht genügend Menschen gab. Also rief sie temporäre Arbeitskräfte aus Italien, Spanien, Griechenland oder der Türkei nach Deutschland. Das ist die Geburtsstunde des sogenannten Anwerbeabkommens.
„Was viele Menschen heute vergessen:
Die Gastarbeiter:innen wurden nicht gerufen,
weil man sie wollte,
sondern weil man sie brauchte“
2021 feierte das türkisch-deutsche Anwerbeabkommen 60-jähriges Jubiläum. Viele der Arbeitskräfte, die bis zum Anwerbestopp 1973 kamen, blieben auch in Deutschland, holten ihre Familien nach und zeugten weitere Generationen. Mich zum Beispiel. Menschen aus meiner Generation neigen oft dazu, die Geschichten ihrer Eltern und Großeltern zu romantisieren. Es gibt mittlerweile Bücher, Ausstellungen und Denkmäler, die das Ankommen in den 1960er- und 1970er-Jahren porträtieren. Schnulzige Sprüche wie „Deutschland rief Arbeiter, aber es kamen Freunde“ prägen unser heutiges Bild von der „Gastarbeitergeneration“.
Aber ganz so schnulzig war und ist es nicht. Was viele Menschen heute vergessen: Die Gastarbeiter:innen wurden nicht gerufen, weil man sie wollte, sondern weil man sie brauchte: als Hilfskräfte oder Zuarbeiter:innen in körperlich anspruchsvollen Berufen, zum Beispiel in der Bauwirtschaft oder im Dienstleistungsgewerbe. Bauen oder Putzen – das waren Berufe, die die Deutschen nicht wollten, die sie lieber für ihre „Gäst:innen“ aufsparten. Wie wirkliche „Gäst:innen“ wurden die Arbeitskräfte aber nicht behandelt: Sie bekamen oft nur sanierungsbedürftige Wohnungen, erlebten Rassismus und auch strukturelle DiskriminierungDie institutionelle (=strukturelle) Diskriminierung bezeichnet die Summe individueller Entscheidungen und Taten von Menschen, die in wichtigen Institutionen Machtpositionen innehaben: Richter:innen, Polizist:innen, Ärzt:innen, Journalist:innen, Menschen, die bei der Ausländerbehörde arbeiten oder in Banken über Kreditvergabe entscheiden. Strukturelle Diskriminierung bildet das Skelett unserer Gesellschaft. Die Infrastruktur hinter der Diskriminierung sozusagen. Quelle: Dr. Emilia Roig. Das deutsche All-inclusive-Paket.
Meine Oma zum Beispiel arbeitete in der Wäscherei eines Hotels. 27 Jahre lang atmete sie giftige Chemikalien ein, schleppte schwere Wäsche hin und her, beugte sich auf und ab. Sie schuftete sich krank – so sehr, dass sie aus gesundheitlichen Gründen in Frührente ging. In ihrem Heimatdorf kümmerte sich indes niemand um ihre jüngste Tochter. Die Tochter verstarb, während die Mutter im Ausland ihr eigentlich ein besseres Leben ermöglichen wollte. Noch heute, wenn meine Oma betet, entschuldigt sie sich bei ihrer Tochter.
Aufklärung statt symbolischer Würdigung
Man kann sagen: Menschen wie meine Oma haben sich für Deutschland aufgeopfert. Und was bekamen sie zurück? 1980 wurde der Gastarbeiter Sydi Koparan aus Ludwigsburg von Nazis totgeprügelt, in Duisburg verübte eine Frau 1984 einen Brandanschlag auf ein Haus, das von einer Gastarbeiter:innenfamilie bewohnt war, in Hamburg wurden 1985 Ramazan Avcı und Mehmet Kaymakçı von Neonazis ermordet. Es folgten die NSU-Morde, der Brandanschlag in Solingen und Hanau. Die Liste der Anschläge ist lang, es sind keine Einzelfälle und für die meisten Menschen der Mehrheitsgesellschaft immer noch unbekannt.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte Anfang Oktober bei einer Festrede zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens, dass die Geschichten der Gastarbeiter:innen gewürdigt werden sollten, zum Beispiel in den Schulbüchern und in unserer Erinnerungskultur. Leider bekamen Menschen wie meine Oma bis heute nichts zurück, was ihre Leistungen würdigte.
Wofür sich der Bundespräsident, aber vor allem auch die Regierung bedingungslos einsetzen könnten – anstelle von Lippenbekenntnissen und Schulbucheinträgen: rechte Strukturen aufdecken, wie es zum Beispiel eine Recherche der taz gemacht hat, oder sich um die vollständige Aufklärung des NSU oder des Terroranschlags in Hanau kümmern. Aber das passiert nicht. Stattdessen werden weiterhin die klassischen „Vom Arbeiter zum Freund“-Geschichten erzählt. Und das Bundesverdienstkreuz verdient ein Sohn türkischer Gastarbeiter:innen auch erst, wenn er einen Impfstoff erfindet, der die Welt rettet.
Es hat einen Grund, warum Menschen wie meine Oma heute wieder in das Land zurückgehen, das sie damals aus wirtschaftlichen und politischen Gründen verlassen haben. Die deutsche Gesellschaft hat es ihnen nicht einfach gemacht, in diesem Land anzukommen. Und statt kritisch darüber zu berichten, sind viele sicherlich damit beschäftigt, die nächste herzzerreißende Gastarbeiterstory in ihren Magazinen zu drucken.
Beitragsbild: Berlin, DEUTSCHLAND – 01.03.1992: In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung wurden in Ost-Berliner Bezirken oft Container aufgestellt um Döner-Kebap zu verkaufen. Hier ein Imbiss-Container in Berlin Marzahn. Im Hintergrund ein PKW der Marke Trabbi. @Metin Yilmaz

fürs DEMOS MAG
Du willst das DEMOS MAG unterstützen, weil guter, diverser Journalismus Dir am Herzen liegt und Du auch denkst, dass Demokratie keine Selbstläuferin ist? Dann spende einmalig mit einer eSpende oder werde Abonnent:in auf Steady.
Fördere mit uns den gesellschaftlichen Diskurs und gib mit Deiner Spende den im Mainstream unterrepräsentierten Stimmen mehr Gewicht.